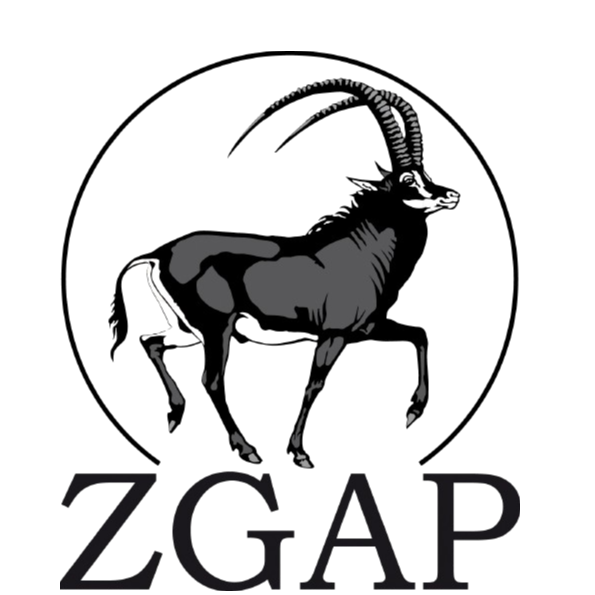UWE - Eine Initiative des Zoo Schwerin und seiner Gäste

Mit den Erlösen des Umwelt-Euro "UWE" unterstützen der Zoo Schwerin und seine Besucherinnen und Besucher Umweltschutzprojekte in und um Schwerin, sowie in-situ und ex-situ Artenschutzprojekte weltweit.
Mit UWE regionale Biotope retten
Mit dem UWE, dem Umwelt-Euro des Zoo Schwerin, besondere Lebensräume und Arten in der Stadt, der Region und der Welt retten
Im Jahr 2021 startete der Zoo Schwerin eine Initiative, die es jedem Zoo-Besuchenden ermöglicht, sich unkompliziert am Thema Umweltschutz zu beteiligen – mit UWE, dem Umwelt-Euro.
Das Thema Umweltschutz hat in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit gewonnen. Immer mehr Menschen machen sich Gedanken, wie sie einen Beitrag leisten und zum Beispiel ihre alltäglichen Gewohnheiten anpassen können. Doch um erfolgreich zu sein, braucht es Aufklärung – eine der wichtigsten Aufgaben von Zoos. Der Zoo Schwerin beschäftigt sich umfangreich mit dem Thema und möchte vermehrt auf bedrohte Tier- und Pflanzenarten sowie schützenswerte Lebensräume hier in der Region aufmerksam machen.
Folglich entstand die Idee alle Schwerinerinnen und Schweriner mit einzubeziehen und die Kräfte zu bündeln. Eine Möglichkeit musste her, bei der jede Person mitmachen und die Stadt gemeinsam handeln kann. Mit dem Umwelt-Euro bekommt jeder Zoo-Besuchende die Möglichkeit, sich für den Erhalt von Biotopen zu engagieren. Jeder Euro, jeder UWE, fließt zu 100 Prozent in ausgewählte Projekte.
Der Umwelt-Euro pro Person auf den regulären Eintrittspreis ist eine freiwillige Abgabe. Natürlich ist niemand verpflichtet, diesen zu zahlen. Die Entscheidung trifft jede Person an der Kasse.
Wer möchte, kann übrigens auch unabhängig vom Zoo-Besuch direkt für das Projekt spenden.
Kiebitzschutz
Projektpartner: NABU Mecklenburg-Vorpommern
Projektausführung: 2023
Projektziel: Steigerung des Bruterfolges der Kiebitze
Projektausführung: Im Frühjahr 2023 startete das NABU-Kiebitzschutz-Projekt im Siebendörfer Moor, wo sechs Mitglieder der Schweriner NABU-„Orni-Gruppe“ erste Erfahrungen im Wiesenvogelschutz sammelten. Das Projekt basiert auf mehrjährigen Beobachtungen und Erkenntnissen, dass der Bruterfolg der Kiebitze gesteigert werden muss, um die Art zu erhalten. Hauptprobleme sind die Prädation der Nester durch Raubsäuger und ungünstige Bewirtschaftung.
Zum Schutz der Nester wurden Geflügelzäune mit Weidezaungeräten angeschafft, finanziert durch Fördermittel der Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV und dem Zoo Schwerin. Der Aufbau des Zauns begann am 18. März 2023, jedoch verhinderten hohe Wasserstände und starkes Altgras die Verstromung des Zauns. Wildschweinaktivitäten verursachten zusätzlich Unebenheiten, die den Zaunbau erschwerten.
Trotz der Herausforderungen zeigten die Beobachtungen, dass die Kiebitze die umzäunte Fläche zur Nahrungssuche nutzten, auch wenn keine Brutaktivitäten festgestellt wurden. Im Mai ging das Wasser zurück, aber die Vegetation wuchs weiter, wodurch die Verstromung unmöglich blieb. Der Zaun erwies sich dennoch als nützlich, um Störungen zu reduzieren.
Am 7. Juni wurde ein Schlupferfolg beobachtet. Der Zaun wurde am 5. Juli abgebaut. Das Projekt erbrachte wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Eignung der Fläche und der technischen Anforderungen.
Für die Zukunft ist geplant, das Projekt fortzuführen, eventuell auf eine bessere Fläche zu verlagern und notwendige Gerätschaften, wie einen Freischneider, anzuschaffen. Ziel ist es, den Zaun früher aufzubauen und regelmäßige Freischnitte durchzuführen, um den Bruterfolg der Kiebitze weiter zu unterstützen.
Wiedereinführung des Braunen Brüllaffen

Projektpartner: Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e.V.
Projektausführung: April 2022 - Februar 2023
Projektziel: Wiedereinführung des Südlichen Braunen Brüllaffen (Alouatta guariba clamitans) auf der Insel Santa Catarina
Projektbeschreibung: Der Südliche Braune Brüllaffe (Alouatta guariba clamitans) kommt nur im Atlantischen Regenwald vor, ursprünglich auch auf der Insel Santa Catarina im gleichnamigen Bundesstaat. Aufgrund intensiver Abholzung, landwirtschaftlicher Nutzung und großem Jagddruck wurden die Affen dort aber bereits vor 300 Jahren ausgerottet. In den letzten Jahrzehnten haben die Reduzierung der Landwirtschaft und die Einrichtung von Schutzgebieten in einem großen Teil der Insel eine Erholung des Lebensraumes und seiner Vegetation ermöglicht. Der Sekundärwald befindet sich in verschiedenen Stadien der Regeneration. Diese Regeneration ging jedoch aufgrund der Inselgeografie nicht mit der Rückkehr der ursprünglichen Tierarten einher. Um in diesen "leeren Wäldern" wieder die Biodiversität zu erhöhen, wurde eine Tierart gesucht, die hinsichtlich ihrer Ansprüche als Generalist klassifiziert werden kann und gleichzeitig dem Lebensraum einen ökologischen Nutzen bringt. Der Südliche Braune Brüllaffe erfüllt alle Kriterien. Die Art hat kleine Verbreitungsgebiete und akzeptiert eine breite Nahrungspalette. Sie fungiert als Samenverbreiter und trägt zum Nährstoffkreislauf bei. Im Rahmen dieses Projekts wurden die notwendigen Gesundheitsprüfungen durchgeführt, das konkrete Wiederansiedlungsgebiet überwacht und vorbereitet sowie Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen mit den lokalen Gemeinden auf der Insel durchgeführt.
Wiederansiedlung von Trauerseeschwalben in Schwerin
Projektpartner: BUND Schwerin
Projektausführung: 2022
Projektziel: Ansiedlung von Trauerseeschwalben im Schweriner Seengebiet, Förderung des Bestandes in Mecklenburg-Vorpommern, Etablierung und Sicherung von Niststandorten, Öffentlichkeitarbeit, Aufklärung
Projektbeschreibung: Trauerseeschwalben sind Zugvögel. In Mecklenburg-Vorpommern kamen die Vögel einst im gesamten Bundesland vor. Wüstnei und Clodius (1900) geben das Vorkommen der Trauerseeschwalbe in Mecklenburg als nicht selten an und nennen Kolonien am Schweriner See (Döpe) und am Ostorfer See. Mittlerweile sind Trauerseeschwalben eine seltene Brutvogelart. Insgesamt leben noch ca. 200 (stand 2020) Brutpaare im Land. Die Vögel werden in der Roten Liste MV als vom Aussterben bedroht geführt und gelten als extrem gefährdet. In der Vergangenheit waren insbesondere Entwässerungen sowie Rückgang der Schwimmblattvegetation infolge Gewässerverschmutzungen die Hauptursache für den zahlenmäßigen Rückgang in den Kolonien bzw. deren Aufgabe. Natürliche Koloniestandorte sind flache Gewässer wie die Polder bei Anklam oder Seerosenfelder in Seen. Im Schweriner Seengebiet existieren momentan keine Trauerseeschwalben-Kolonien mehr. Es werden aber regelmäßig Vögel auf dem Zug beobachtet. Diese sind auf der Suche nach Nistmöglichkeiten.
Pflege von Kopfweiden

Projektpartner: Fachdienst Umwelt Landeshauptstadt Schwerin
Projektausführung: 2022
Projektziel: Erhalt der alten und damit ökologisch und kulturhistorisch besonders wichtigen Kopfweiden sowie der damit verbundenen Artenvielfalt der Kulturlandschaft entlang des Aubachs
Projektbeschreibung: Durch ihr unverwechselbares Aussehen verleihen die Bäume der Landschaft eine charakteristische Eigenart und Schönheit. Gleichzeitig erfüllen Kopfweiden wichtige ökologische Funktionen, z. B. als Lebensraum für zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten.
Hier befindet sich das Projekt.
Chaco-Pekari

Projektpartner: Chaco Center for Conservation and Research
Projektausführung: seit 2022
Projektziel: Erforschung und Zucht des Chaco-Pekaris
Projektbeschreibung: CCCI begann seine Aktivitäten 1985 mit dem Ziel, das Chako-Pekari zu erforschen und zu züchten. Die Gründung erfolgte als Reaktion auf den alarmierenden Rückgang der Population dieses wiederentdeckten Art. Das Projekt konzentriert sich auf die Aufzucht der Tiere in Menschenobhut. Sobald die Tiere das Erwachsenenalter erreichen, werden neue Familiengruppen gebildet, mit dem Ziel, sie später in die Wildnis zu entlassen.
Im Zuchtzentrum wird großer Aufwand betrieben, um den Gesundheitszustand der Tiere zu erhalten. Dazu gehörten regelmäßige Gesundheitsüberwachungen und kontinuierliche Beobachtungen, um Daten über ihr Verhalten und ihre genetischen Merkmale zu sammeln.
Schutzmaßnahmen des Moorkomplexes Schelfvoigtsteich
Projektpartner: Stadtwerke Schwerin GmbH, Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
Projektausführung: 2021 - 2022
Projektziel: Errichtung einer kleinen Stauanlage am vorhandenen Graben zur Feuchterhaltung des Moorkomplexes. Geplant ist außerdem, mit einer Beobachtungsplattform eine bessere öffentlich zugängliche Naturbeobachtung zu ermöglichen
Projektskizze: Bei dem Schelfvoigtsteich nördlich des Ruheforstes, handelt es sich um eine ehemalige Bucht des westlich angrenzenden Ziegelaußensees, mit dem das Gebiet über einen Graben verbunden ist. Kalkreicher Untergrund neben sauren Böden sowie der kleine Moorkomplex zeichnen diesen Standort aus und machen ihn trotz der relativ kleinen Fläche so attraktiv für eine Vielzahl an gefährdeten, seltenen Pflanzenarten. Dazu zählen unter anderem Armleuchteralgen, Seerosen, die Untergetauchte Wasserlinse, der Wasserschlauch und verschiedene Torfmoose. Sogar gesetzlich geschützt sind der Erlenbruchwald, der Sumpffarn- und der Schneidenröhricht sowie Großseggensümpfe. Aus der Tierwelt liegen ebenfalls konkrete Daten vor. So fühlen sich hier insgesamt 23 Libellenarten und 24 Arten von Wasserkäfern genauso wohl wie Kammmolch und Laubfrosch, Schellente und Eisvogel. Am Rande Schwerins auf gerade einmal acht Hektar so viele verschiedene, höhere Arten anzutreffen, ist schon sehr besonders. Zusätzlich liegt der Schelfvoigtsteich im EU-Vogelschutzgebiet der Schweriner Seen. Doch das kostbare Biotop droht durch verstärkten Baumaufwuchs zu verschwinden. Im Sommer gibt es hohe Wasserverluste. Außerdem ist der Wasseraustausch mit dem Ziegelaußensee gestört. Zu viel nährstoffreiches Wasser gelangt in diese nährstoffarme Region. Kleinflächig gesehen sorgt das für eine zusätzliche Klimabelastung. Der Lebensraum für die vielen Wasser- und Moortiere und -pflanzen könnte verschwinden, wenn nichts unternommen wird.
Hier befindet sich das Projekt.
Himmelblauer Zwergtaggecko
Projektpartner: Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e.V.
Projektausführung: seit 2021
Projektziel: Rettung des Himmelblauen Zwergtaggeckos in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet
Projektbeschreibung: Das Hauptverbreitungsgebiet des Himmelblauen Zwergtaggeckos befindet sich im Kimboza-Wald in Tansania. Dort lebt er auf Pandanuspalmen in Waldresten, die stark durch Brände, invasive Baumarten und Abholzung gefährdet sind. Zum Schutz des Lebensraumes werden 10 km Brandschneisen gegen Waldbrände gelegt. Weiter wird die invasive Baumart Cedrela odorata gerodet, damit sich die Pandanuspalme besser verbreiten kann. Auch die lokale Bevölkerung wird ausgebildet und als Waldhüter für Anti-Wilderer-Patrouillen eingesetzt.
Erfolgreicher Abschluss des ZGAP Rothundprojektes in Nepal unterstützt durch den Zoo Schwerin
Im Zoo Schwerin lebt ein ganzes Rudel der in der Natur selten gewordenen Rothunde. Der Asiatische Rothund gilt ökologisch als wichtigster Beutegreifer in den Mittelgebirgen Nepals. Gleichzeitig ist er leider stark bedroht, da er von der lokalen Bevölkerung als potentielle Gefahr für Nutztierherden gesehen und daher massiv bejagt wird. Das vom Zoo Schwerin geförderte, befristete Projekt der ZGAP (Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz) zielte darauf ab, die Bewegungen der Rothunde und Nutzung ihrer Lebensräume im Annapurna Schutzgebiet an der Grenze zu Tibet besser zu verstehen sowie die Bedrohungen zu bewerten, damit ihre Erhaltung zukünftig gesichert werden kann. In dem Gebiet wurden Kamerafallen aufgestellt und illegale Aktivitäten und Schlingfallen dokumentiert und entfernt. Neben den Rothunden wurden dabei auch Arten wie Leoparden und Nebelparder, aber auch potenzielle Beutetiere des Rothundes wie Muntjaks, Wildschweine und Himalaja-Serau fotografiert. Rothunde ernähren sich von großen Paarhufern, deren Zahl und Vielfalt in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. Steigende Wildschweinbestände geben jedoch Anlass zur Hoffnung, dass auch die Rothundpopulationen zukünftig ansteigen können und sich unabhängig von Nutztierherden entwickeln. Finanziert wurde das Projekt aus den Einnahmen des 3. Zoolaufes im Jahr 2020. Nur durch solche Projekte kann der Artenschutz vorangetrieben werden und gehört zu den Aufgaben eines modernen Zoos dazu.